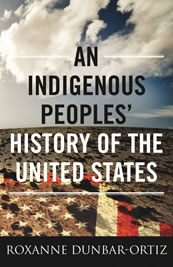 The absence of even the slightest note of regret or tragedy in the annual celebration of the US independence betrays a deep disconnect in the consciousness of US Americans.
The absence of even the slightest note of regret or tragedy in the annual celebration of the US independence betrays a deep disconnect in the consciousness of US Americans.
Seinem neuesten Roman »Hart auf hart« hat T.C. Boyle als Epigraph ein Zitat von D.H. Lawrence vorangestellt: »The essential American soul is hard, isolate, stoic and a killer.« Lawrence bezieht sich bei dieser Feststellung auf die Hauptfigur der Lederstrumpf-Romane von James Fenimore Cooper aus dem 19. Jahrhundert. Der bekannteste dieser Romane dürfte »Der letzte Mohikaner« sein, der auch denjenigen irgendwie vertraut ist, die ihn nie gelesen oder eine Verfilmung gesehen haben. Das zeigt, wie tief die Version der amerikanischen Geschichte, die Cooper darin festgeschrieben hat, in unseren Köpfen verankert ist. Höchste Zeit, dass die Geschichte der USA einmal aus der Perspektive der Gegenseite erzählt wird: aus der Sicht der Indianer.
Dieser Aufgabe hat sich die amerikanische Historikerin Roxanne Dunbar-Ortiz in ihrem Buch »An Indigenous Peoples‘ History of the United States« gewidmet, von dem leider bis jetzt keine deutsche Übersetzung vorliegt. Geht Boyle nun schon, wie es typisch für ihn ist, in seinem Roman mit beliebten amerikanischen Mythen hart ins Gericht, so geht Dunbar-Ortiz noch weiter. Sie stellt die Geschichte Amerikas von 1607 bis ins 21. Jahrhundert als eine einzige, lange Widerstandsbewegung der ursprünglichen Bevölkerung gegen europäische Kolonisierung und Imperialismus dar. Dabei spannt sie einen weiten Bogen – von den Kreuzzügen und der Leibeigenschaft europäischer Bauern über Hexenverbrennungen bis hin zum aktuellen Krieg der USA gegen den Terrorismus.
Das Klischee, das uns vor allem von Western vertraut ist, stellt Amerika immer als eine unberührte, nur von vereinzelten nomadischen Indianerstämmen bewohnte Wildnis dar, als die Europäer dort ankamen. Vielmehr lebten aber auf dem Gebiet der heutigen USA zu dieser Zeit Schätzungen zufolge rund sieben Millionen Indianer, und zwar nicht wie steinzeitliche Jäger und Sammler, sonder überwiegend von der Landwirtschaft und in Dörfern, sogar Städten und Stadtstaaten. Ein Jahr nach der Ankunft der ersten Europäer war ihre Zahl um 90 Prozent reduziert, aber das war, wie Dunbar-Ortiz zeigt, nicht in erster Linie den Krankheitserregern geschuldet, die die Europäer zufällig einschleppten, sondern den gezielten Ausrottungsaktionen der neuen Siedler, die eigentlich Eroberer waren.
Sie zeigt außerdem, wie das Töten von Indianern zum identitätsstiftenden Merkmal für Generationen von Amerikanern wurde und wie sehr sich die USA belügt, wenn sie behauptet, sie verabscheue eine Kriegsführung, die Zivilisten in Mitleidenschaft zieht. Denn genau das war das Hauptmerkmal beim Vorgehen gegen die Indianer: Die Siedler aus Europa vernichteten gezielt die Lebensgrundlage der Ureinwohner, indem sie ihre Häuser und ihre Erntevorräte verbrannten sowie ihre Felder verwüsteten. Dunbar-Ortiz führt zahlreiche Beispiele an, in denen Siedlermilizen extreme Gewalt gegen Frauen, Kinder und Alte anwendeten und dafür als Helden in die Geschichte eingingen.
Coopers Helden sind Menschen, die erkennen, dass der ganze Schnickschnack der europäischen Zivilisation nicht viel nützt, wenn man in Amerika überleben will, wobei Überleben vor allem heißt, den Kampf gegen die Indianer nicht zu verlieren. Wer sich an christliche Gebote hält, etwa nicht zu töten oder auch die andere Wange hinzuhalten, überlebt in Coopers Romanen höchstens durch die Hilfe anderer. Daraus hat sich die Vorstellung entwickelt, in der Auseinandersetzung mit den Indianern und der Natur habe sich ein speziell amerikanischer Charakter im Unterschied zum Europäer herausgebildet, ein Typ Mensch, der auf sich allein gestellt in der Natur überleben kann, Gewalt als legitimes Mittel zur Konfliktlösung ansieht und dafür nicht auf staatliche Einmischung wartet, weil die Regierung erstens weit weg und zweitens unfähig ist – genau so ein Typ also wie Boyles Adam.
Dunbar-Ortiz ist es mit ihrem Buch gelungen, die dunklen Seiten dieses amerikanischen Charakters zu erhellen. Obwohl ihr Buch eine vernichtende Kritik der üblichen Geschichtsschreibung darstellt, macht es auch Hoffnung, dass die USA – und Europa – irgendwann doch einmal anerkennen, welche Schuld sie im Umgang mit indigenen Völkern weltweit auf sich geladen haben, und Schritte zur Wiedergutmachung einleiten könnten. Auf jeden Fall ist ihr Buch ein Muss für alle, die sich für Amerika interessieren.
Roxanne Dunbar-Ortiz: An Indigenous Peoples‘ History of the United States
Englisch | Beacon Press 2015 | 312 Seiten
Sabine Anders

Danke für diesen Buch-Tipp! Das Thema der Unterdrückung indigener Völker in „entdeckten“/eroberten Gebieten ist nicht nur für die USA relevant, sondern allein im englischen Sprachraum mindestens ebenso für Kanada und Australien. Bis heute steht in all diesen Ländern eine echte Aussöhnung ‚auf Augenhöhe‘ mit den betroffenen indigenen Kulturen noch aus.
Darüber hinaus scheint das Buch den ethnozentrischen Bias der Mehrheitsbevölkerung treffend zu entlarven.- Ich freue mich darauf, das Buch selbst zu lesen.
Gerade in einem Artikel wie diesem halte ich jedoch eine Differenzierung für wichtig: Die Bezeichnung „Indianer“ ist nicht mehr zeitgemäß. Die indigene Bevölkerung nennt sich selbst beim jeweiligen Stammesnamen – oder als Sammelbezeichnung „Native Americans“ (Gebiet der heutigen USA) oder „First Nations“ (Gebiet des heutigen Kanada). Ich hoffe, dass eine eventuelle kommende deutsche Übersetzung des Buches dies berücksichtigen wird.
Die Bezeichnung „Indianer“ ist im deutschen Sprachgebrauch nicht so abwertend wie im englischsprachigen Raum, selbst im Englischen ist „Indian“ und insbesondere „American Indian“ trotz allem noch im Rahmen des politisch Korrekten. Natürlich wird die Bezeichnung von manchen abgelehnt, aber mangels einer besseren Alternative stuft auch Wikipedia „Indianer“ als „relativ diskriminierungsarm“ ein. Eine deutsche Übersetzung des Buches gibt es leider (noch?) nicht.